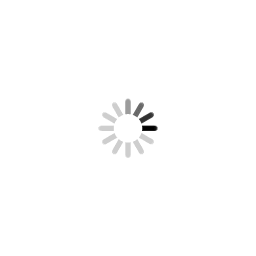Text aus dem Indikatorenbericht 2022
Datenquelle der Indikatoren ist die EU-Arbeitskräfteerhebung, die in Deutschland in den Mikrozensus integriert ist. Die Arbeitskräfteerhebung findet unterjährig statt und wird von der europäischen Statistikbehörde Eurostat zunächst zu Quartalsergebnissen zusammengefasst und anschließend zu Jahresdurchschnittswerten verdichtet. Sie deckt die in privaten Haushalten lebende Bevölkerung ab, schließt jedoch Personen in Gemeinschaftsunterkünften aus. Die im Rahmen der Arbeitskräfteerhebung betrachtete erwerbstätige Bevölkerung besteht aus Personen im Alter ab 15 Jahren, die während der Referenzwoche mindestens eine Stunde eine Tätigkeit gegen Entgelt ausgeübt haben oder als unbezahlt mithelfende Familienangehörige tätig waren. Eingeschlossen sind auch Personen, die nur vorübergehend nicht gearbeitet haben, weil sie zum Beispiel wegen Urlaub oder Krankheit abwesend waren. Zu beachten ist, dass es im Zeitablauf bei der Arbeitskräfteerhebung (zum Beispiel Anpassung an Ergebnisse des Zensus 2011) und mit der Neuregelung des Mikrozensus 2020 Änderungen gab, die Einfluss auf die zeitliche Vergleichbarkeit der dargestellten Zeitreihen haben.
Die Erwerbstätigenquote insgesamt (20- bis 64-Jährige) stieg von 68,7 % im Jahr 2000 um 10,9 Prozentpunkte auf 79,6 % im Jahr 2021. Der Zielwert von 78,0 % für 2030 wird bereits seit 2015 erreicht. Die Erwerbstätigenquote bei den Älteren (60- bis 64-Jährige) nahm deutlich von 19,6 % im Jahr 2000 um 41,5 Prozentpunkte auf 61,1 % im Jahr 2021 zu. Die Quote der Männer in dieser Altersgruppe hatte sich dabei um 38,5 Prozentpunkte auf 65,7 % mehr als verdoppelt. Die Quote der Frauen verfünffachte sich sogar fast von 12,1 auf 56,7 %. Der angestrebte Anteil von 60 % bei Älteren wird seit 2018 jeweils erreicht und damit ebenfalls vor der in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie gesetzten Frist.
Die Erwerbstätigenquoten von Frauen und Männern insgesamt entwickelten sich seit 2000 in dieselbe Richtung, jedoch in unterschiedlichem Umfang. Die Quote stieg bei den 20- bis 64-jährigen Männern im betrachteten Zeitraum um 6,7 Prozentpunkte auf 83,2 %, bei den Frauen dagegen um 15,2 Prozentpunkte auf 75,9 % und damit deutlich stärker, aber auch von einem niedrigeren Niveau aus. Bei einer Bewertung des Anstiegs der Erwerbstätigenquote der Frauen ist zu berücksichtigen, dass die Erhöhung der Quote mit einer Zunahme der Teilzeitbeschäftigung einherging. Im Jahr 2000 waren 61,5 % der Frauen in Vollzeit und 38,5 % in Teilzeit tätig. Im Jahr 2021 lagen die Anteile bei 52,3 % in Vollzeit und 47,7 % in Teilzeit. Im Vergleich dazu reduzierte sich der Anteil der Männer, die in Vollzeit tätig sind, von 95,7 % im Jahr 2000 auf 89,8 % in 2021.
Bei einer Differenzierung der Erwerbstätigenquote nach Altersgruppen zeigten sich unterschiedliche Tendenzen. Bei der Gruppe der 20- bis 24-Jährigen erhöhte sich die Erwerbstätigenquote von 2000 bis 2021 nur marginal um 2,4 Prozentpunkte auf 67,2 %. In der Altersgruppe der 25- bis 59-Jährigen stieg diese hingegen um 7,7 Prozentpunkte auf 83,9 %. Das geringere Erwerbsniveau in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen ist bedingt durch Ausbildungszeiten an Schulen und Hochschulen, wodurch sich der Eintritt in das Berufsleben verschiebt.